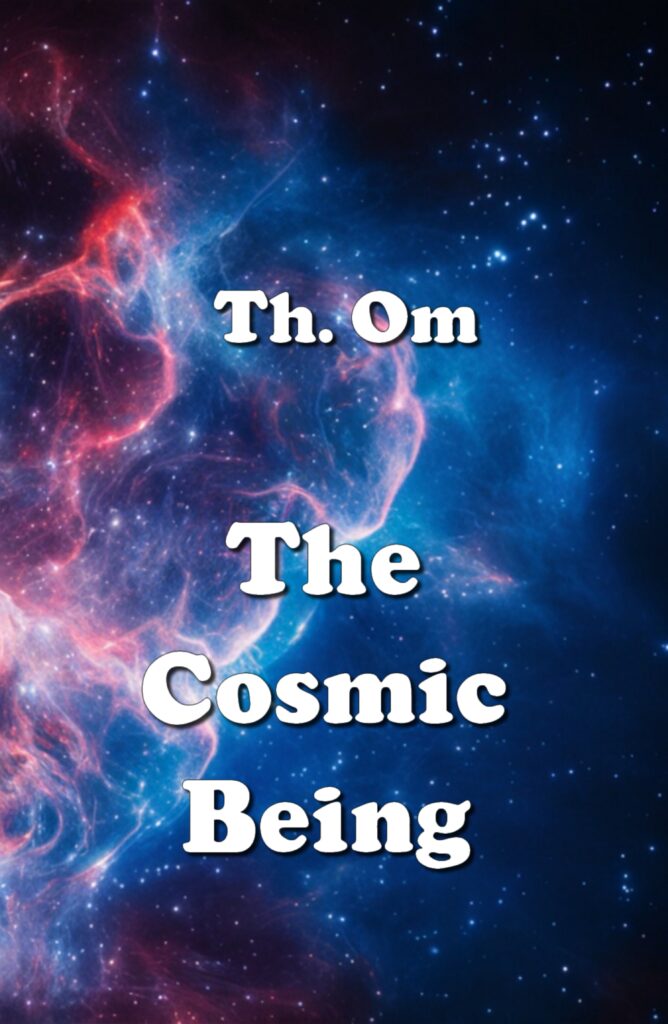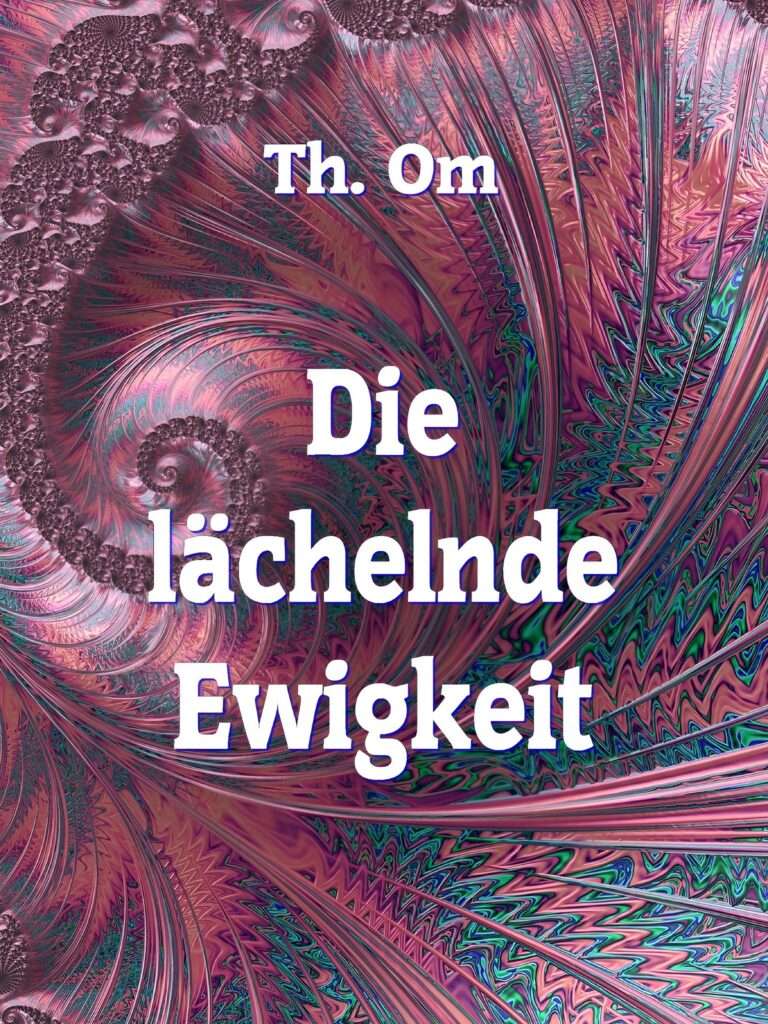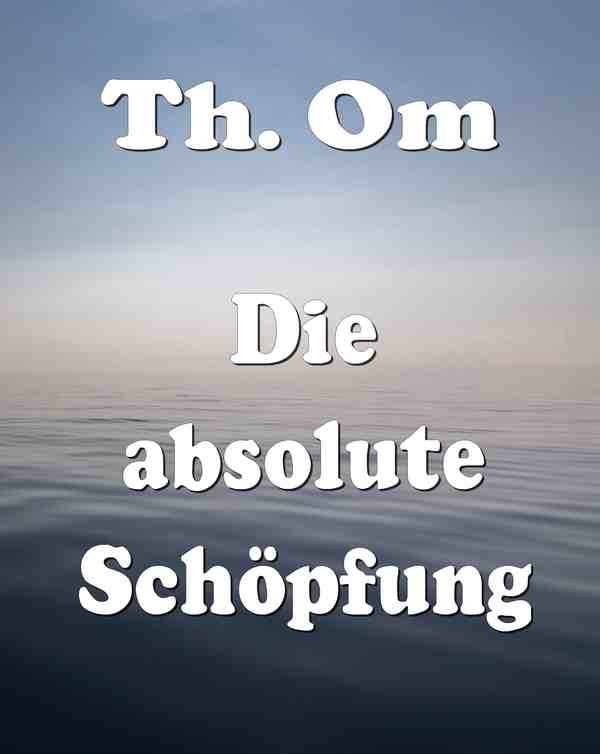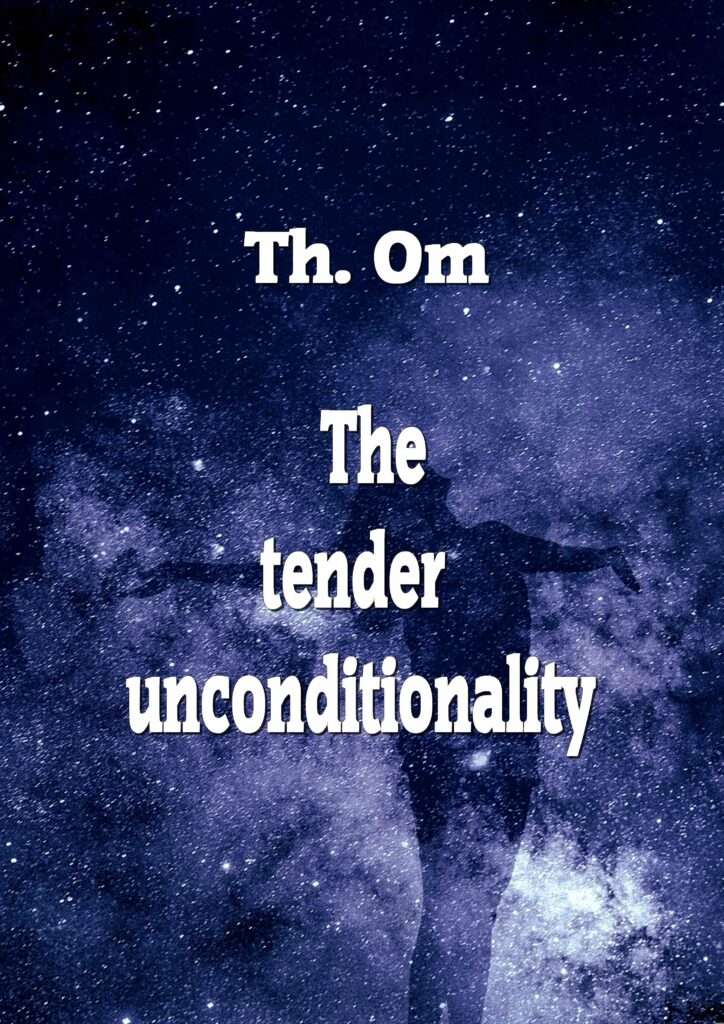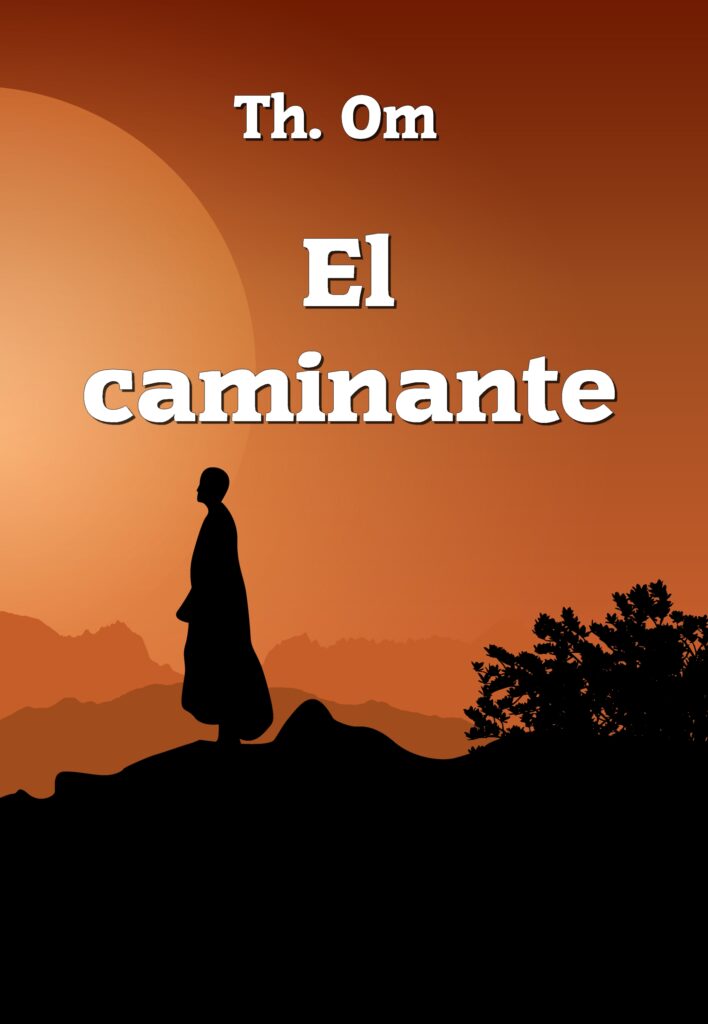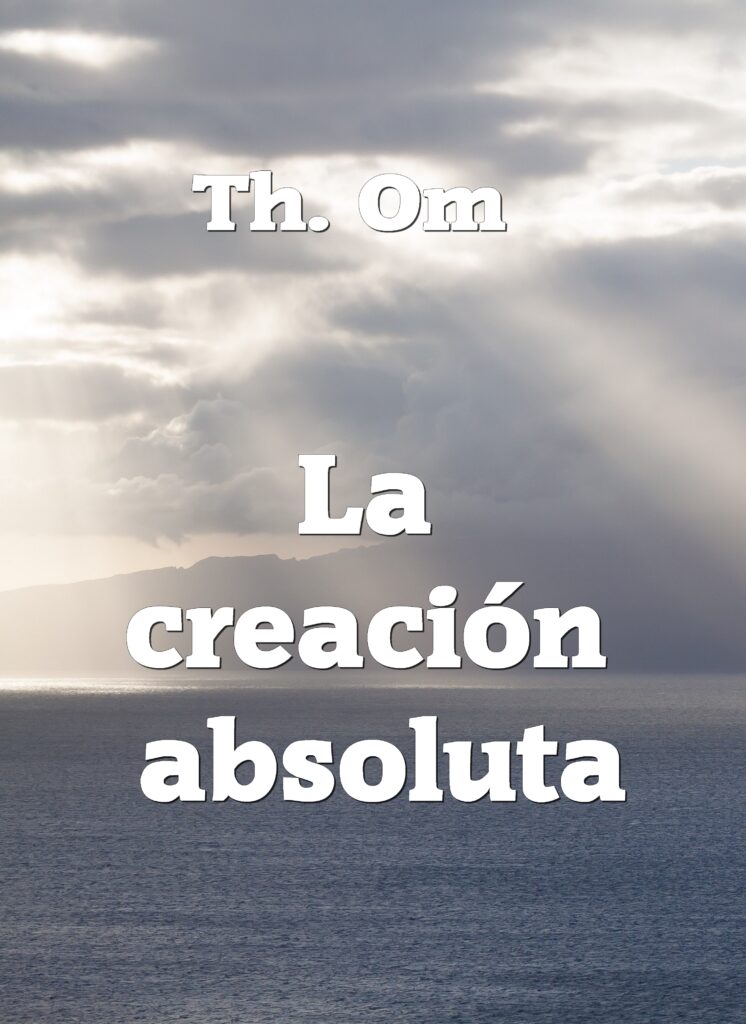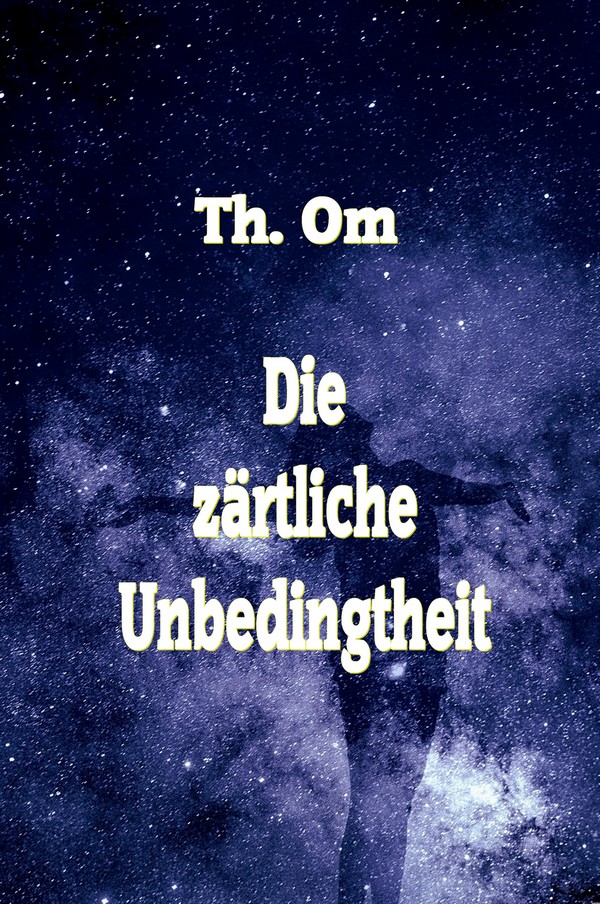Tun und Lassen
Als „Anspruch“ bezeichnet die Rechtswissenschaft das Recht, „von einem anderen ein Tun, ein Dulden oder ein Unterlassen zu verlangen.“ So ein Anspruch hat Ansprüche – um einen solchen also zu erlangen, muss man gewisse Wertigkeiten vorweisen können. So hatte ein Weißer in den Südstaaten des vorherigen Jahrhunderts das „Anrecht“ den „Anspruch“, aus einem Trinkbrunnen zu trinken, von dem keine Menschen mit anderer Hautfarbe Wasser entnehmen durften. Der Anspruchsgrund: seine weiße Haut. Gesellschaftskondition.

Gesellschaftsmoral?
Ein Adeliger im Mittelalter hatte, unter anderem, den Anspruch, das Anrecht, sich von Leibeigenen die Stiefel küssen zu lassen. Die Frage nun, worin diese Ansprüche jeweils begründet sind, wo ihre Ursache zu finden ist, drängt sich unmittelbar auf. In den obigen Beispielen ist es eindeutig ein „gesellschaftspolitischer“ Anspruch. Will meinen, die Anspruchsbegründung ist in gesellschaftlicher Klasseneinteilung zu finden.
Ausgerufene Differenz
Immer bedeutet ein „Anspruch“ klares Werturteil, welches sich aus postulierten Unterschieden ergibt. Die große Frage, die sich nun unzweifelhaft stellt, ist die nach dem Ausrufer dieser Wertigkeiten. Wer legt die Ansprüche des Einzelnen, einer Allgemeinheit, einer Gruppe fest? Wer stellt fest, wer weniger Wert auf einer unbestimmten Skala hat, wer mehr davon? Es sind die Gesellschaftswerte, Hierarchien – solange wir uns mit ihnen messen lassen.
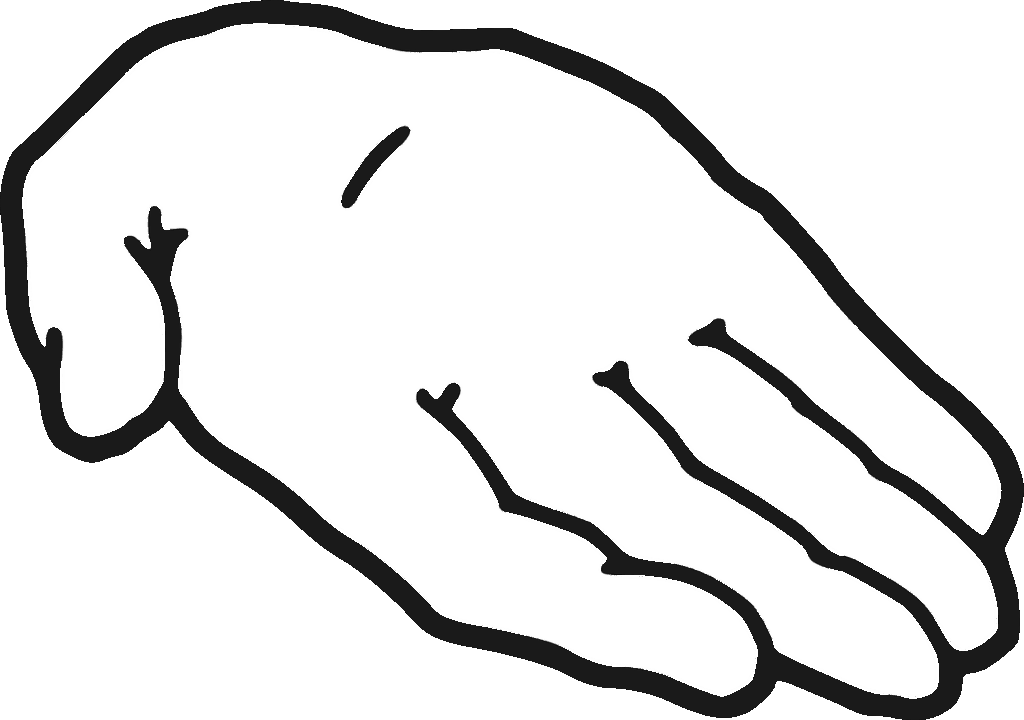
Anspruch auf Erlösung?
Besonders subtil und geradezu seltsam wird die Sache, wenn wir das Wort „Anspruch“ auf der spirituellen Ebene finden. Gibt es Menschen, die mehr Anrecht auf Erlösung, auf Erleuchtung, auf Frieden und Glück haben, als andere? Wir können sehen, dass das, was „Anrecht“ oder „Anspruch“ meint, sich in Gegenwart der Liebe rasant auflöst. „Liebe“ ist von gesellschaftlichem, dinglichem „Anspruch“ so weit entfernt, wie es nur irgend geht.
Dualistisches Geben und Nehmen
Jeder Anspruch des Einen, bedeutet einen „Verlust“ des anderen. Das dualistische Bild von „Geben“ und „Nehmen“ in Perfektion. Mit dem Geltend machen eines „Anspruches“ ziehen wir eine Trennungslinie. Wenn der Anspruch eine Gunst ist – also ein Anrecht, das gewährt wird, weil eine wirkliche Notwendigkeit, die Vernunft, die Liebe, sie „befiehlt“ so kann man sie nicht mehr einen Anspruch nennen.

Klassenunterschied
Der einfache, rohe Anspruch dagegen beruht auf einer Art von generell postuliertem „Klassen“-unterschied. Das gefährliche an dieser Begrifflichkeit ist, sie benötigt nahezu keinerlei Belege – der „Grund“ für den sogenannten „Anspruch“ mag aus der Luft gegriffen sein. Doch immer beruft er sich auf die Konditionen des Gesellschaftsdenksystems. „Der Anspruch“ per se ist ein Geltendmachen der dualistischen Gesetze – es gilt ihn zu durchschauen, aufzulösen, zu vergessen.

Vereinter Anspruch
Es gibt jedoch einen gemeinsamen Anspruch aller Menschen – und dieses Anrecht steht „über“ allen Gesetzen und Regeln und Moralismen und Algorithmen, Mechanismen und jedem Urteilsgehabe – und das ist die unbedingte, die absolute Liebe. Dies ist der Einzige, mit vollkommenem, durchdringendem Recht geforderte Anspruch, das einzig wirksame und gültige Anrecht der Menschheit: Die Liebe der Schöpfung.
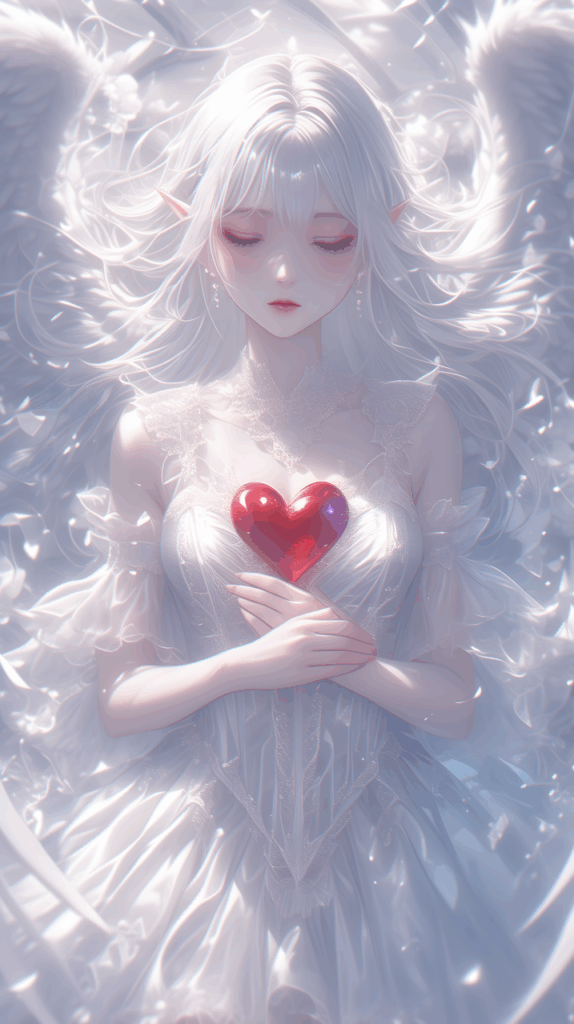
Fazit
Es ist offene Tatsache, dass wir dieses Anrecht auf Erfüllung nicht einmal fordern müssen – es ist uns bereits in jedem Sekundenbruchteil gegeben. Dieses Anrecht auf vollkommnene Liebe entsteht aus uns selbst, die wir Kinder der absoluten Liebe – und somit durch und durch Fleisch gewordene Liebe sind. Das einzige, was uns also noch zu tun bleibt, ist, diese wunderbare, allumfassende Liebe auch zu leben – springen wir erst einmal über den dunklen Schatten der Gesellschaft – hüllt sie uns in strahlendes Licht.
Das Wollknäuel – oder die zerstörerischen Kräfte der Wissenschaft